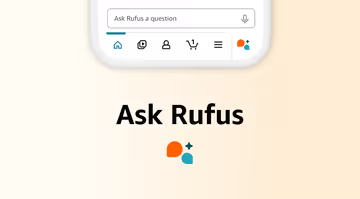Wird sich Agentic Commerce jemals durchsetzen?
Wie so viele Revolutionen des Online-Shoppings könnten die Agenten an einem scheitern: der menschlichen Psychologie.

Im März hatte ich bereits hier darüber geschrieben, dass AI-Agents eine potenzielle Bedrohung für die Werbeeinnahmen von E-Commerce-Anbietern sein könnten, weil die Agenten im Gegensatz zu Menschen keine Werbung konsumieren würden. Als mögliche Lösung präsentierte Cloudflare einige Wochen später sein Pay-per-Crawl-Modell, das die Anbieter auf andere Weise vergütet, und Shopify veröffentlichte einen MCP-Server, mit dem Agenten auf die Daten seiner Millionen von Händlern zugreifen können – wobei die finale Kaufentscheidung nach wie vor von einem Menschen getroffen werden muss. Gleichzeitig ist Amazon vorerst komplett aus dem Rennen ausgestiegen und hat alle AI-Agents von seiner Webseite verbannt. Wie steht es nun also um Agentic Commerce und wird es eines Tages wirklich das gesamte Online-Shopping automatisieren?
In der aktuellen Folge des MDM-Podcasts diskutieren Eric Seufert und Andrew Lipsman diese Frage und haben eine klare Antwort: Nein. Denn Agenten stoßen bei vielen Nutzern auf rein psychologische Vorbehalte:
- Menschen wollen im Kaufprozess involviert sein, wenn mehrere Faktoren zu berücksichtigen sind und/oder es um viel Geld geht (z. B. beim Kauf eines Autos), da das Risiko eines Fehlkaufs hier am höchsten ist.
- Transaktionen mit geringer Komplexität (z. B. der Kauf von Lebensmitteln) bieten nur minimalen Mehrwert, da sie bereits einfach sind (z. B. zwei Klicks bei Amazon) und die Fehleranfälligkeit trotzdem verhältnismäßig hoch ist.
- Mangelndes Vertrauen in Plattformen: Frühere Versuche in diese Richtung, wie z. B. Voice Commerce via Alexa, wurden von Nutzern weitestgehend abgelehnt. Außerdem wollen Nutzer bei falschen Bestellungen einen direkten Ansprechpartner haben, und Plattformen wie OpenAI oder Google sind im Kundenservice bei Weitem nicht so gut aufgestellt wie E-Commerce-Anbieter.
- In einem Affiliate-Modell, wie OpenAI es scheinbar plant, könnte nicht der Nutzer, sondern die Plattform (hier: OpenAI) von der Transaktion profitieren, indem der Agent gezielt Produkte auswählt, bei denen sein Besitzer die höchste Kommission erhält. Und nicht die, die für den Nutzer am günstigsten oder am besten geeignet sind.
Das heißt, auch wenn die Agenten in der Zukunft zuverlässig einkaufen könnten, würden viele Menschen diese Verantwortung aufgrund eines oder mehrerer dieser Gründe nicht abgeben. Es scheint daher, als wäre der Ansatz von Amazons „Buy for Me“ und Googles „Agentic Checkout“ der richtige: Es geht nicht darum, den kompletten Kaufprozess abzubilden, sondern ihn erneut ein kleines bisschen schneller und reibungsloser zu gestalten.